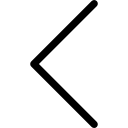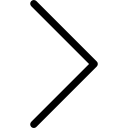In den fast 5 Jahren in denen ich Konzerte fotografiere und über sie schreibe, habe ich öfters mal einzelne Musiker als Virtuosen bezeichnet. Als erster Musiker, den ich live erleben durfte, reicht mir das Wort für Steven Wilson nicht aus. Ich tue mich schwer, das Wort “Genie” für einen Musiker zu verwenden, aber wenn es jemand verdient hat, dann Steven.
Gitarrist, Keyboarder, Sänger, Komponist, Produzent, Ton-Ingenieur – und das alles als Autodidakt. Eher zufällig entstand aus einer Laune heraus seine bisher erfolgreichste Band “Porcupine Tree”. Eine der prägendsten Bands des Progressive Rock-Genres in den 2000ern. Aber Steven Wilson ist nicht einfach nur Prog-Rock. Seine musikalische Experimentierfreudigkeit führt ihn zu zahlreichen Projekten verschiedenen Richtungen. Poppige Klänge variieren mit harten Rhythmen und sehr melancholischen Stimmungen und wechseln auch mal gern in den psychedelischen 70er Jahre Sound.
Auch seine Beteiligung am Indie-Spiel “Last Day of June” ist ein Meisterstück. Mit seiner Untermalung schafft er es, eine unbeschreibliche Atmosphäre aufzubauen, die von kindlicher Unschuld über den glücklichsten Moment des Lebens zu tiefer Traurigkeit reicht. Und das in einer Fantasiewelt, in der zahlreiche, miteinander verknüpfte Handlungsstränge von Figuren ohne Mimik und ohne Worte erzählt werden. Leider war der Soundtrack von “Last Day of June” nicht Teil des Livesets, das Steven Wilson im Mehr! Theater vor knapp 3.500 musikbegeisterten Besuchern präsentiert hat.
Steven Wilsons Musik ist größtenteils nicht zum Tanzen und Nebenbeihören gedacht, sondern Kunst mit Tiefgang. Das zeigt allein das Intro “Truth”, bei dem zahlreiche Bilder mit wechselnden Beschriftungen im immer schnelleren Wechsel gezeigt werden. Die sozialen Medien sind nacheinander “Nachrichten”, “Gleichgültigkeit” und Lüge, ein Polizeieinsatz wird als “Sicherheit”, “Nachricht” und “Hass” tituliert, das Bild vom Ku Klux Klan als “Hass” und dann als “Religion”. Dazu spielt im Hintergrund ein angenehmruhiger Track, der immer bedrohlicher wird. Vorab bittet Steven Wilson noch aktiv darum, dass das Publikum darüber reflektieren soll, wie sie sich beim Ansehen des Clips fühlen.
Direkt danach gibt es den ersten Live-Song “Nowhere now” von seinem 2017er Album “To the bones”, für das er seit eineinhalb Jahren tourt – und vor einem Jahr zwei Konzerte in Hamburg gab. Für Steven’s Verhältnisse ist der Song schnell, einfach, fast schon fröhlich trotz seiner ernsten Texte. Es folgt die Ballade “Pariah”, bei der das Gesicht seiner Duett-Partnerin Ninet Tabyet auf eine durchsichtige Leinwand projiziert wird, hinter der man die Band aber noch gut sehen kann.
In den folgenden Liedern wird die Bandbreite von Wilson sehr deutlich, sowohl konzeptionell als auch spielerisch und im Gesang. Gern beginnt er einen Song am Keyboard und füllt die Melodien von Gitarre, Bass und E-Piano mit warmen Flächen um dann noch im selben Song an die E-Gitarre zu wechseln und die gleiche Melodie mit harten Rhythmen rockig aufzuladen. Dann kündigt er an, beim nächsten Gitarrensolo nicht auf die Gitarre zu gucken, weil er die hochtechnisierten, “olypmischen” Gitarristen hasst, bei denen es nicht mehr um Musik, sondern nur noch um Präzision und Timing geht. Und seiger die Stimmung mit seinem hoch-psychedelischen Song “Ancients” inkl. Geigenbogen-Einsatz auf der Lead Gitarre, um das Publikum dann eiskalt in eine Pause zu schicken.
In der zweiten Hälfte sieht man Wilson von seiner fröhlich-poppigen, von ABBA-inspirierten Seite, dann ist er wieder nachdenklich, um zuletzt in seiner Zugabe zwei Songs nur mit Gesang, Gitarre und Klavier im “Singer Songwriter Style” wirken lässt.
Am Schluss gibt es einen “einfach nur depressiven” Song. Zu “The raven that refused to sing” vom gleichnamigen Album aus 2013, wird nochmal ein traurig-schönes Video gezeigt, dass gekonnt mit einem melancholisch-melodischen Song untermalt wird. An dessen Ende traut man sich ein paar Sekunden lang nicht zu applaudieren, um die wunderbare Atmosphäre nicht zu zerstören.